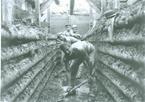Mit Salpeter auf großer Fahrt
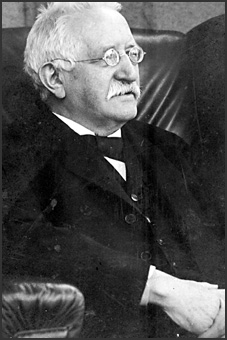 Hermann Conrad Johannes Fölsch reiste 1866 nach
Südamerika und gründete gemeinsam mit dem Deutsch-Chilenen Frederico
Martin 1872 in Iquique in der Atacamawüste im Norden Chiles ein
Unternehmen zur Gewinnung von Salpeter. Fölschs Jugendfreund
und späterer Schwager Henry B. Sloman reiste ihm nach und
arbeitete zwanzig Jahre als sein Geschäftsführer, bevor er sich
selbstständig machte und in Chile sein eigenes
Salpeterimperium aufbaute. Die Geschäfte entwickelten sich
ungewöhnlich erfolgreich. Chilesalpeter war der wichtigste
Rohstoff zur Herstellung von Anilinfarben, Sprengstoffen und
Düngemitteln, und so wurde Deutschlands entstehende
Agrarindustrie zum bedeutendsten Abnehmer von Chilesalpeter in Europa. Dadurch
prosperierte vor allem der Hamburger Hafen: innerhalb von 40 Jahren
steigerte sich die Einfuhr von Salpeter um das knapp 40fache auf
509.800 Tonnen im Jahr 1905, woran die Firmen von H.C.J.
Fölsch und Henry Sloman einen sehr großen Anteil
hatten.
Hermann Conrad Johannes Fölsch reiste 1866 nach
Südamerika und gründete gemeinsam mit dem Deutsch-Chilenen Frederico
Martin 1872 in Iquique in der Atacamawüste im Norden Chiles ein
Unternehmen zur Gewinnung von Salpeter. Fölschs Jugendfreund
und späterer Schwager Henry B. Sloman reiste ihm nach und
arbeitete zwanzig Jahre als sein Geschäftsführer, bevor er sich
selbstständig machte und in Chile sein eigenes
Salpeterimperium aufbaute. Die Geschäfte entwickelten sich
ungewöhnlich erfolgreich. Chilesalpeter war der wichtigste
Rohstoff zur Herstellung von Anilinfarben, Sprengstoffen und
Düngemitteln, und so wurde Deutschlands entstehende
Agrarindustrie zum bedeutendsten Abnehmer von Chilesalpeter in Europa. Dadurch
prosperierte vor allem der Hamburger Hafen: innerhalb von 40 Jahren
steigerte sich die Einfuhr von Salpeter um das knapp 40fache auf
509.800 Tonnen im Jahr 1905, woran die Firmen von H.C.J.
Fölsch und Henry Sloman einen sehr großen Anteil
hatten.Um den Handel mit Chilesalpeter in der Hand zu behalten, gründete H.C.J. Fölsch 1881 eine eigene Reederei. 1914 hatte die Firma vier Segler mit gut 9000 Nettoregistertonnen. Aufgrund der gefährlichen Route um das Kap Hoorn war es ein Geschäft mit hohem Risiko, versprach aber enorme Einnahmen: Die stählerne Viermastbark Passat der Hamburger Reederei Ferdinand Laeisz konnte über 4000 Tonnen Chilesalpeter transportieren, das entsprach einem Frachtwert von über einer Million Mark (heute ca. zehn Millionen Euro). H.C.J. Fölsch investierte seine Gewinne vor allem in Immobilien. Nach und nach kaufte er mehrere Grundstücke und Häuser am Hamburger Rathausmarkt. Daraus ist nach dem Zweiten Weltkrieg direkt gegenüber vom Hamburger Rathaus der „Fölsch-Block“ entstanden, der sich bis heute im Familienbesitz befindet.
H.C.J. Fölsch schloss sich der Herrnhuter Brüdergemeine an. Als Freund von Johannes Wichern engagierte er sich für gefährdete Jugendliche, spendete große Summen und stiftete 1906 in Hamburg Häuser in der Fehlandtstraße und an der Esplanade zur Einrichtung eines Christlichen Kellnerheims. Daraus entstand später das Hotel Baseler Hof.